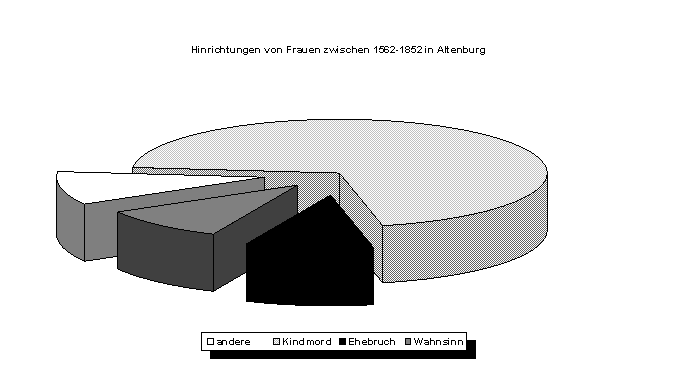 (93)
(93)
Allgemeine, durch die historische Forschung nachgewiesene wirtschaftliche und soziale
Entwicklungen spiegeln sich auch in den aus den Häftlingslisten gewonnenen Daten wider und
belegen diese. Die große Anzahl der untersuchten Personen (5195) hat Ergebnisse mit
repräsentativem Charakter erbracht. Herausgeschält hat sich in der Arbeit, daß sich die
grundlegenderen Veränderungen in den Lebenswelten der untersuchten Häftlinge um 1800
vollzogen (83).
Der Wandel der Einweisungsursachen um 1800 spiegelt eine veränderte soziale Wirklichkeit
wider. Vor 1800 überwiegen die sozialen Einweisungsursachen. Die außerhalb der
Ständepyramide existierenden verarmten Unterschichten werden kriminalisiert. Nach 1800
sind die meisten Häftlinge auf Grund von Eigentumsvergehen inhaftiert. Der sich
durchsetzende Kapitalismus wird nicht von außerhalb der alten Ständepyramide existierenden
Gruppen angegriffen, sondern eher von solchen Gruppen gefördert. Ein wesentliches
Fundament der kapitalistischen Gesellschaft ist das Privateigentum. Der Angriff auf das
Privateigentum wird zum hervorstechenden Massendelikt und gleichzeitig zu der am
häufigsten verfolgten Deliktgruppe. Der Wechsel der Deliktarten um 1800, von Sozial- zu
Eigentumsdelikten, ist Ausdruck des sich in dieser Zeit vollziehenden gesellschaftlichen
Wandels (84).
Die Angaben zum Stand der Häftlinge ermöglichen es, die großen wirtschaftlichen Wandlungen der Zeit auch an Hand der Gefangenen nachzuvollziehen. Außerdem lassen sich die Häftlinge mit Hilfe der Angaben zu ihrem Stand in soziale Schichten einordnen. Nimmt man die Ausübung eines Berufes (Ausbildung mit einer Prüfung) als ein Kriterium für die Einordnung in eine bürgerliche Schicht, so erfüllen mehr als 90% der Häftlinge dieses Kriterium nicht. Jedoch auch in der Gruppe der Gefangenen mit Beruf überwiegen Gesellen und Lehrlinge, die sicher ebenfalls eher zu unterbürgerlichen Schichten gehören. Denn selbst Handwerksmeister hatten im 19. Jahrhundert oft nicht die Möglichkeit eines standesgemäßen Lebens. Es kann davon ausgegangen werden, daß die Häftlinge, bis auf wenige Ausnahmen, unterbürgerlichen Schichten zuzuordnen sind. Neue Berufsbezeichnungen, wie Handarbeiter treten nach 1800 gehäuft auf (85).
Jedoch auch die industrielle Revolution findet ihren Niederschlag in einem sprungartigen
Anwachsen der gewerblich tätigen Häftlinge.
Etwas mehr als 3/4 der Häftlinge sind Männer.
Die Zäsur in der Altersstruktur für die bis 15 jährigen und die über 51 jährigen Häftlinge ist um 1800 anzusetzen. Im letzten Vierteljahrhundert vor 1871 wurde nur noch ein Kind eingewiesen. Die Einlieferung alter Menschen erfolgte nach 1800 seltener. Auf Grund von gesellschaftlichen Veränderungen und der Gründung neuer professionalisierter Anstalten befanden sich nach 1800 kaum Kinder und weniger Alte in den Leuchtenburger Anstalten.
Die Altersverteilung der Gesamtbevölkerung (Pyramide - viele junge und wenige alte Menschen) in Verbindung mit der großen kriminellen Anfälligkeit junger Männer und den noch näher zu untersuchenden Disziplinierungsmaßnahmen des Staates gegenüber jungen Frauen erklärt den großen Umfang der jungen Häftlingsgruppe.
Ältere Häftlinge werden seltener auf Grund von Eigentumsvergehen inhaftiert.
Eigentumsvergehen sind mit Aktivität und Handeln verbunden. Diese Strategie zur Meisterung
von Armut ist gebrechlichen, alten Menschen versperrt. Überproportional viele alte Männer
befinden sich vor allem im Zuchthaus. Die höhere Lebenserwartung der Männer, die
Unterscheidung zwischen würdigen und unwürdigen Armen sowie die Geschlechterrollen sind
hierfür verantwortlich.
Die zunächst erstaunlich hohe Schulbildung der Häftlinge erklärt sich aus der langen Tradition der Volksschulbildung in den Staaten des protestantischen Thüringens. Lese- und Schreibkenntnisse sind für die unterbürgerlichen Schichten offensichtlich nützlicher gewesen als Religionskenntnisse. Die vorhandenen geschlechtsspezifischen Unterschiede müssen später erläutert werden.
Ein Ergebnis der Arbeit ist die Frage, ob die "Lebenswelten" das dynamischere Prinzip in der
Geschichte sind. Ob politisches Handeln, wie die preußischen Reformen, letztlich nur
Reaktionen auf einen bereits veränderten Alltag sind. Damit soll die prägende Kraft derartiger
Reformen oder Revolutionen nicht eingeschränkt werden. Die Frage ist eher, ob der bereits
veränderte Alltag die Reformen oder Revolutionen "notwendig" machte und damit in gewissem Grad auch deren Richtung bestimmte.
Eine erste Durchsicht der Ergebnisse einer geschlechtsspezifischen Auswertung der Daten der
Häftlinge verspricht Einblicke in die Geschlechterrollen und kann ungleiche Lebenschancen
aufzeigen. Der Frage, weshalb gerade die Gruppe der 20 bis 30 jährigen Frauen
überproportional vertreten ist, wäre nachzugehen (86). Erklärungsbedarf deutete sich durch eine
Voruntersuchung der geschlechtsspezifischen Veränderungen der Deliktarten in Abhängigkeit
vom Lebensalter an (87). Dies mündet in einer
Untersuchung der "Straftaten", die nur bzw.
vorzugsweise von Frauen begangen werden. Einige der Repressionen, unter denen Frauen
litten bzw. leiden, sind so zu erhellen (88). Auch wenn, wie Gitta Benker zeigt, Frauen nicht
rechtlos waren, sondern eine weitgehende Kontrolle über das dörfliche Zusammenleben
ausübten (89), wird die Arbeit zeigen können, daß staatliche Sanktionen in diesem
Zusammenhang ausschließlich bzw. vorwiegend Frauen trafen (90). Auch scheint die Autorin
eher ein verzeichnetes Bild des Zeitgeistes entworfen zu haben (91).
Eine Zusammenstellung der Hinrichtungen in Altenburg zeigt eine interpretationswürdige
deutliche Tendenz der Delikte, für die Frauen "bevorzugt" bestraft wurden (92). Viele Fragen
drängen sich auf, bis hin, ob es eine Kontinuität der Kriminalisierung von Frauen
beispielsweise im Zusammenhang mit dem § 218 gibt.
Prostituierte, eine kleine Gruppe der weiblichen Häftlinge, werden eine besondere Beachtung
finden. Ayaß stellt für einen späteren Zeitraum fest, daß Prostituierte neben Bettlern und
Landstreichern die größte Insassengruppe der Arbeitshäuser sei (94). Unter anderem ist zu
klären, weshalb gerade um die Jahrhundertwende dieser Teil der weiblichen Gefangenen
überproportional vertreten war. Die deutlichen Unterschiede in der Schul- und Berufsbildung
der Frauen gegenüber den Männern wird die Kontinuitäten in der Benachteiligung, die durch
traditionelle Geschlechterrollen bedingt sind, darstellen.
Es ist möglich, die Entwicklungslinien des Umgangs mit Delinquenz und Randgruppen durch
das Einbeziehen der Ergebnisse der Arbeit von Ayaß vom Ancien Régime bis 1949
nachzuzeichnen. Zu prüfen wäre, ob die Verbreiterung des Datenbestandes durch die
Auswertung weiterer Häftlingslisten helfen würde, wesentliche zusätzliche Erkenntnisse zu
gewinnen. Tiefgehende Einsichten verspricht der Vergleich der Ergebnisse der Arbeit mit den
Arbeiten, die zur Zeit in Dublin und London auf der Basis der Auswertung von Häftlingsverzeichnissen entstehen.
Das Bild ist durch die Hinzuziehung der Akten des Altenburger Staatsarchivs (Gerichtsakten,
Verwaltungsakten der Leuchtenburger Anstalt, etc.) abzurunden.
Zu prüfen ist die Möglichkeit, den wichtigen Deliktgruppen entsprechend, einige reale
Lebensläufe zu rekonstruieren (95). Hierzu sind auch die Regesten, die im Archiv des
Pfarramtes Unterbodnitz lagern, durchzusehen. Einzelschicksale können dem zu
entwickelnden Bild exemplarisches Kolorit geben. Auch für einzelne weniger häufige
Deliktarten ist der soziale Kontext am Einzelfall zu rekonstruieren (96).
Eine differenziertere und eingehendere Auswertung des vorhandenen Datenbestandes verspricht tiefere und detailliertere Einsichten in die Lebenswelten der Unterschichten. Das vorhandene Material ist bisher fast nur schlaglichtartig ausgewertet worden. Die Kodierung des Textblockes "Lebensweg" ist zu erstellen und auszuwerten, analog der Kodierung des Textblockes "Charakter" (97).
Zusammengenommen verspricht eine ausführlichere Untersuchung eine spannende und
interessante Arbeit zu werden.
In der Magisterarbeit diente die Datenbank der Häftlingslisten und deren statistische
Auswertung der ansatzweisen Rekonstruktion der Lebenswelten unterbürgerlicher Schichten.
Der Nutzen empirischer Arbeiten für die historische Forschung kann kaum überschätzt werden. Die Datenbank der Leuchtenburger Häftlinge soll für andere Arbeiten zugänglich
gemacht werden. Der Vergleich mit bzw. die beispielhafte Anregung für ähnlich statistisch
arbeitende Untersuchungen kann erleichtert werden, indem die Datenbank im WWW (98) zugänglich ist. Die Magisterarbeit bzw. weitere Aufsätze sollten ebenfalls online verfügbar sein.
Den Nutzen zu prüfen, der sich aus dem Internet für die Kommunikation der historischen
Forschung und deren Anregung ergibt, wäre ein wesentliches erkenntnisleitendes Interesse
einer weiteren Auswertung des Datenmaterials.
|
|

|

|
|