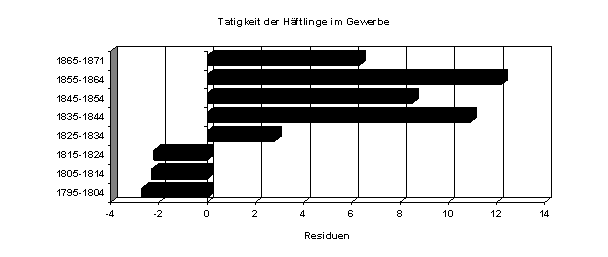
(59)
Die Häftlingslisten geben für die meisten Häftlinge den Stand bzw. das Gewerbe an.
Aus den Berufsbezeichnungen sind die Wirtschaftssektoren, in denen die Häftlinge tätig sind,
abzuleiten. Außerdem ist der Grad der Ausbildung aus den Berufsbezeichnungen zu ermitteln.
Der Ausbildungsgrad dient der Einordnung in soziale Schichten.
Im Untersuchungszeitraum verändern sich die Tätigkeiten der Unterschichten grundlegend.
Für die Auswertung scheint problematisch, daß auch identische Berufsbezeichnungen
zwischen 1724 und 1871 nicht mit gleichen lebensweltlichen Erfahrungen verbunden sind. Die
vorherrschende landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit wird von der gewerblichen abgelöst
(56).
Der wirtschaftliche Umbau der Gesellschaft nach 1800 spiegelt sich in drastisch veränderten
Anteilen der Wirtschaftssektoren, in denen die Häftlinge tätig sind, wider.
Vor 1800 ist die überwiegende Zahl der Häftlinge in der Landwirtschaft tätig (36,8%). Die Beschäftigung im Gewerbe mit der klaren Zuordnung zu handwerklichen Betriebsformen (23,0%) ist der zweite entscheidende Wirtschaftssektor, der den Lebensunterhalt der Delinquenten sichert. Die anderen gewerblichen Betriebsformen können mit 17 Häftlingen vernachlässigt werden. "Erst mit dem Beginn der Industrialisierung am Ende der 1830er Jahre fingen die gewerblichen Verhältnisse in Deutschland allmählich an, sich grundlegend zu wandeln" (57).
Nach 1825 ist die Gruppe der Häftlinge, die in gewerblichen Betrieben tätig ist, die nicht handwerklich organisiert sind, erstmals überproportional stark vertreten, nach 1835 wächst diese Gruppe sprungartig (58).
Der Anteil der im Dienstleistungsgewerbe tätigen Häftlinge verringert sich von 16,1% vor 1800 auf 11,5% nach 1800.
Die gravierendste Veränderung findet jedoch in der Landwirtschaft einerseits und im Gewerbe
andererseits statt. D.h., daß die gewerbliche Produktion überproportional wächst und die
Industrie neu entsteht. Die landwirtschaftliche Produktion wird vom Gewerbe als Leitsektor
abgelöst. Quantitativ wachsen in der Landwirtschaft die Erträge beträchtlich, jedoch nicht im
gleichen Umfang wie im Gewerbe. Die große Bedeutung der Landwirtschaft läßt sich für den
untersuchten lokalen Bereich auch noch 1869 an der Marktordnung der Stadt Kahla ablesen
(60). Der gesamtgesellschaftliche Wandel beginnt sich nach 1800 beschleunigt durchzusetzen
und findet auch seinen Ausdruck in einer veränderten Erwerbsstruktur der Unterschichten. Die
Beschäftigung im gewerblichen Sektor nimmt rasant zu.
| Gewerbe | Landwirtschaft | |
| vor 1800 | 23,0% | 36,8% |
| nach 1800 | 62,5% | 19,9% |
| Gewerbe ohne Handwerk | Landwirtschaft | |
| vor 1800 | 1,0% | 36,8% |
| nach 1800 | 28,0% | 19,9% |
Für den Zeitraum vor 1800 gibt Pierenkemper ein Verhältnis zwischen Landwirtschaft und
Gewerbe von 62% zu 21% an (63). Daß die Gruppe der Häftlinge, die in der Landwirtschaft vor
1800 tätig war sehr viel kleiner ist, als die aus dem von Pierenkemper angegebenen
gesamtgesellschaftlichen Verhältnis zu erwartende Anzahl, scheint verschiedene Ursachen zu
haben. Die innerhalb des ständischen Aufbaus der Gesellschaft fest integrierten Personen
scheinen wesentlich seltener kriminell gewesen zu sein. Der Polizeiapparat bekämpfte
vorzugsweise Randgruppen, diese waren auch überproportional in der Leuchtenburger Anstalt
vertreten. Sicher trug hierzu auch bei, daß kleinere Vergehen von Mitgliedern der
Dorfgemeinschaft vor 1800 eher innerhalb des Dorfes "bereinigt" wurden. Bauern, die in
Thüringen meist auch die Eigentümer des von ihnen bearbeiteten Landes waren, tendieren
offensichtlich relativ seltener zu Straftaten. Denn der landwirtschaftliche Betrieb, die
Grundlage der Versorgung der Familie, ist ohne die Arbeitskraft aller Familienmitglieder nicht
überlebensfähig. Der Hof ernährte die Dienstknechte und -mägde, so daß diese nur im Falle
der Arbeitslosigkeit auf die selbständige Subsistenzsicherung angewiesen waren.
Einem abrupten gesellschaftlichen Wandel steht zunächst die relative Stabilität im dörflichen
Zusammenleben vor und nach 1800 entgegen. Die Arbeit der Familie auf dem Hof bildet die
Subsistenzgrundlage, Knechte und Mägde bleiben im Hof integriert. Das rapide
Bevölkerungswachstum wird hauptsächlich vom Gewerbe aufgefangen. Vor allem diese
Bevölkerungsgruppe wohnt nun eher zur Miete. Jedoch auch die Zahl der Beschäftigten im
Handwerk verdreifachte sich nahezu zwischen 1800 und 1900 (64). Drastische und für einige
Berufsgruppen sehr schmerzhafte Wandlungen in der inneren Zusammensetzung des
Handwerks vollzogen sich in diesem Zeitraum. Die sich durchsetzende Industrie verdrängte
das Verlagswesen fast vollständig.
Nach 1800 kehrt sich das Verhältnis zwischen den Häftlingen, die landwirtschaftlich oder
gewerblich tätig sind, um. Die Volkszählung vom 3. Dezember 1867 in Sachsen-Altenburg
ergab eine Gesamtbevölkerung von 141.650, von denen 49.526 in Städten lebten (65). Die
Mehrheit der Bevölkerung lebte auf dem Lande. Der Wandel der Erwerbsstruktur der
Häftlinge zeigt, daß auch die Dörfer gewerblich durchdrungen waren. Vor allem für die Zeit
vor 1850 ist von einem großen Anteil des Verlagswesens am Gewerbe auszugehen. Das
Handwerk ist mit einer großen Vielfalt der Berufe (75) (66) in den Leuchtenburger Anstalten
vertreten. Die Zahl der im Handwerk tätigen Häftlinge nimmt nach 1800 noch zu, jedoch nicht
so drastisch wie die Zahl der Häftlinge in anderen gewerblichen Betriebsformen (67). Die im
Handwerk Tätigen waren den Krisenerscheinungen des Handwerks, ausgelöst durch die
partielle Ablösung handwerklicher Arbeit durch Fabrikarbeit, unterworfen.
Für die Zeit vor 1800 werden in der Quelle häufig Berufsbezeichnungen verwendet (21,8%),
die nicht einem Wirtschaftssektor zuzuordnen sind. Hierunter fallen Bettler und Vaganten
(unklar 8,9%), Soldaten, ehemalige Soldaten und Soldatenweiber (Militär 12,4%) und
Zigeuner (Minderheit 0,5%). Nach 1800 schrumpft diese Häftlingsgruppe auf 2,3%
zusammen. Dieser Wandel ist bedingt durch eine neue Einweisungspraktik in die
Leuchtenburger Anstalten. Nicht mehr die außerhalb der Ständepyramide lebenden
"Randgruppen" (unklar = Bettler und Vagabunden, Militär "arbeitslose Soldaten",
Minderheiten = Zigeuner) sind Ziel der Repression des Staates, sondern Personen, die den nun
zunehmend bürgerlich kapitalistisch dominierten Staat durch Eigentumsdelikte angreifen.
Die Berufe lassen den Grad der Ausbildung erkennen. Mit Hilfe des Ausbildungsgrades sind die Häftlinge sozialen Schichten zuzuordnen.
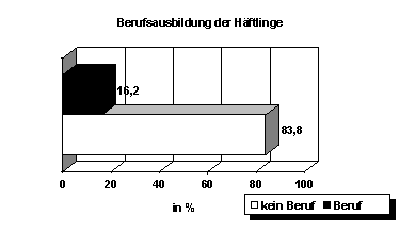
Eine Mehrheit der Häftlinge besitzt sicher Berufserfahrungen (know how). Hierbei handelt es
sich jedoch nicht um ein Wissen, das durch eine Ausbildung (Lehre, Schule oder Studium mit
einer Prüfung) erworben wurde. Die Quellenlage erschwert eine genauere Bewertung des
Wissens der Häftlinge, Unterscheidungen sind schwierig. Die Kenntnisse des Einzelnen sind
schwer zu fassen. Dienstknechte lernten in ihrer Dienstzeit von ihrem Herren, wie dieser den
Hof führte, um später einen eigenen Hof zu übernehmen. Inwieweit dieses "Ideal" zutreffend
ist, kann durch die Quelle nicht nachgeprüft werden.
Als Differenzierungskriterium, ob ein Häftling einen Beruf erworben hat oder nicht, dient
neben der Ausbildung, dem Erwerb von know how (vgl. Dienstknecht oder -magd), auch noch
der Abschluß einer Prüfung (Gesellenstück, etc.). Diesen moderneren Kriterien für einen Beruf
(69) entsprechen vor 1800 9,7% und nach 1800 20,3% der Häftlinge. Der sich durchsetzende
Industriekapitalismus benötigt Arbeitskräfte, die eine abschätzbare, standardisierte Ausbildung
haben. Dies gilt sicher vor allem zunächst für die Führungseliten, ist aber tendenziell auch für
die hier untersuchten Unterschichten nachweisbar.
Gerade die sich im Handwerk vollziehenden Anpassungen an den Industriekapitalismus
sicherten manchem Handwerksmeister kein "standesgemäßes" Leben. Die Situation
verschärfte sich noch für die Handwerker durch den Niedergang des Verlagswesens nach
1800. Die übergroße Mehrheit der Häftlinge besaß jedoch noch nicht einmal einen solchen
Beruf. Eine Grundlage bürgerlichen Lebens ist die Ausübung eines Berufes (mindestens eines
Familienmitgliedes). Diesen Beruf hatten die meisten Häftlinge nicht. Fast die Hälfte der
Häftlinge, die einen Beruf haben, sind Lehrlinge oder Gesellen, deren soziale Stellung sehr
dürftig war. Somit meine ich, daß gut 90% der Häftlinge (die ohne Beruf sowie Lehrlinge und
Gesellen) unterbürgerlichen Schichten zuzuordnen sind.
Eine "Besserung" der Gefangenen sollte erreicht werden durch Arbeit, seelsorgerische Betreuung und Unterricht (70).
Aus der Quelle sind erst ab 1852 Angaben zur Schulbildung zu entnehmen. Für knapp 1000
Häftlinge konnten die Lese- und Schreibkenntnisse und für 843 Häftlinge die
Religionskenntnisse erfaßt werden. Die verbalen Einschätzungen der Kenntnisse der Häftlinge
durch Pastor Leschke sind in ein Notenschema eingepaßt worden (71). Auffallend ist, daß auch
für unterbürgerliche Schichten Lese- und Schreibkenntnisse die Regel sind. Lesen und
Schreiben wurde mit Hilfe religiöser Schulbücher (72) gelehrt. Gute Religionskenntnisse sind
durch den einseitigen religiös fixierten Unterricht zu erwarten und sind in dieser Zeit für breite
Bevölkerungskreise typisch. Die Religionskenntnisse der Häftlinge sind jedoch wesentlich
schlechter als deren Lese- und Schreibkenntnisse.
Da die Pastoren die Häftlinge neben der seelsorgerischen Betreuung auch unterrichteten, hatten sie sicher einen guten Überblick über deren Wissensstand.
Pastor Langes Angaben zur Schulbildung sind zunächst sporadisch. Pastor Leschke (ab 1855)
gibt den Bildungsstand fast jedes Häftlings an. Die Leserevolution der Jahrhundertwende
wirkte auch in die unterbürgerlichen Schichten hinein (75). Das war möglich durch die
besonders in lutherischen Gebieten bereits frühzeitig weit entwickelten Volksschulen (76). In
Sachsen-Gotha gab "Wolfgang Ratke ... 1642 den 'Schulmethodus' heraus, der den
Schulbesuch für alle 'Knaben und Mägdelein' im Alter von sechs bis zwölf Jahren festschrieb
und deshalb als die 'Gründungsurkunde der deutschen Volksschule' gilt" (77). Dieses
Programm wurde so erfolgreich umgesetzt, daß Fremde damals schrieben: "in den Ländern
Herzog Ernstes seien die Bauern gescheiter als die Landedelleute in anderen Gegenden
Deutschlands" (78). Sachsen-Altenburg fiel durch Erbgang 1672 an Sachsen-Gotha.
Daß die Religionskenntnisse (79) etwas schlechter als die Schulkenntnisse eingeschätzt werden, liegt sicher zunächst an dem kritischeren Blick des Pastors auf sie. Hinzu kommt, daß Häftlinge zum Teil entwurzelte Menschen sind und oft durch Schicksalsschläge ihren Glauben an Gott verloren haben. Auch können sich in ungenügenden Religionskenntnissen im Einzelfall Widerstände artikulieren. Im Gruppenverhalten der Häftlinge ist sicher nicht der fromme Kriminelle die Leitfigur. Dieses Zusammenspiel führte eher zu einer Distanz zur Religion als zu einer trostsuchenden Hinwendung.
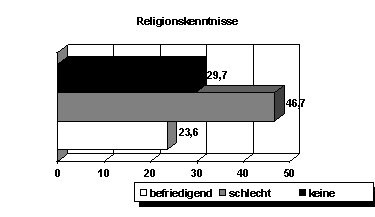
29,7% der Häftlinge mit Angaben zu ihren Religionskenntnissen wird das Nichtvorhandensein
dieser Kenntnisse bescheinigt. Deutlich geringer fällt dieses Urteil für die Lesekenntnisse
(9,2%) (81) und Schreibkenntnisse (15,1%) (82) aus.
Befriedigende oder bessere Kenntnisse hatten im Lesen und Schreiben jeweils mehr als die
Hälfte der untersuchten Häftlinge. Jedoch in den Religionskenntnissen erreichen nur 23,6%
der Häftlinge vergleichbare Leistungen. Der Anteil der ungenügenden und genügenden
Leistungen der Delinquenten ist in der Religion höher als im Lesen und Schreiben.
|
|

|

|
|