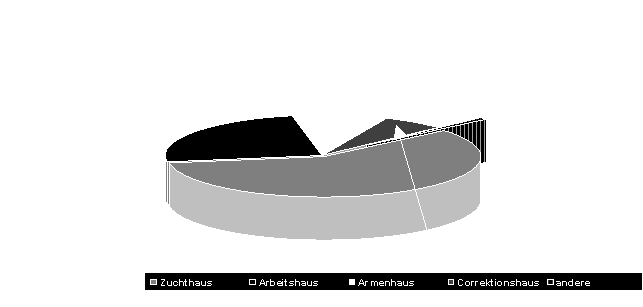 (1)
(1)
Die Leuchtenburger Anstalten wurden zunächst als Zuchthaus und Armenhaus eröffnet. Unter den am 14.09.1724 ersten sechs auf die Leuchtenburg gebrachten Häftlingen befand sich bereits einer, der als Armer bezeichnet wurde. Verbrecher, Bettler, Arme und Kranke fanden in den Anstalten Aufnahme.
Eine Differenzierung der Anstalten erfolgte nur langsam. Frauen und Männer wurden getrennt
untergebracht (2). Die Strafen, die in den Conduitenlisten 1843-1849 belegt sind, zeigen jedoch
selbst für diesen späten Zeitpunkt immer wieder, daß Häftlinge Möglichkeiten fanden, auch
innerhalb des Gefängnisses die Trennung von Frauen und Männern zu überwinden (3). Die
baulichen und sicher auch administrativen Unzulänglichkeiten der Leuchtenburger Anstalten
verhinderten die strickte Trennung von Männern und Frauen, wie dies die prüden Ansichten
der Zeit vorgeschrieben hätten. Kriminelle, Kranke, Arme und Irre waren noch weit weniger
getrennt untergebracht.
Zu Zuchthausstrafen sind die meisten Häftlinge (58,7%) der Leuchtenburger Anstalten
verurteilt worden. 55,2% aller Diebstahlsdelikte der Insassen der Leuchtenburger Anstalten
werden mit Zuchthaus bestraft. Das Zuchthaus ist die einzige Anstalt, die während der
gesamten Zeit ununterbrochen betrieben wurde. Der Wandel und die Kontinuität in den
Intentionen für den Betrieb des Zuchthauses läßt sich an veränderten Einweisungsgründen aus
der Quelle erschließen (4). Die institutionelle Differenzierung zwischen Zuchthaus und den
anderen Leuchtenburger Anstalten hängt vom Wandel der Einweisungskriterien und von der
Gründung neuer Anstalten mit spezialisierten Aufgaben ab. Der Verlauf dieser Differenzierung
und auch die Tendenz des Wandels des Strafsystems wird an den aus dem Zuchthaus
ausgegliederten anderen Leuchtenburger Anstalten deutlich (5).
Das Zuchthaus diente den gesamten Untersuchungszeitraum hindurch der Inhaftierung von
schwerwiegend (6) kriminell Gewordenen. Auf Grund der anfangs fehlenden institutionellen
Differenzierung kamen auch Kleinkriminelle in das Zuchthaus. Für Gewalttäter und Mörder
war das Zuchthaus Verwahrungsort während des gesamten Untersuchungszeitraumes. Die
Gesellschaft des frühen 18. Jahrhunderts definierte Kriminalität teilweise anders als die der
Mitte des 19. Jahrhunderts. Verbrechen, die sich gegen die Grundlagen der Gesellschaft
richten, unterliegen einer besonders strengen Verfolgung. Das Prinzip des ständischen Aufbaus
der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts wird durch die außerhalb der Ständepyramide stehenden
Arbeitslosen und Randgruppen attackiert. Eigentumsdelikte greifen eine wesentliche
Grundlage der bürgerliche Gesellschaft an.
Für die ständische Gesellschaft des 18. Jahrhunderts ist die Bekämpfung der Bettler und
Vaganten eine wichtige Aufgabe. Dies spiegelt sich in dem überwiegenden Anteil der
Einweisungen wegen sozialer Delikte wider. Als Beweggrund für die Eröffnung von
Zuchthäusern wird im 18. Jahrhundert in der Regel die Bekämpfung der Bettler und Vaganten
zuerst genannt (7). Die Einweisung in ein Zuchthaus auf Grund von Bettelei war nur eine der
möglichen Bestrafungen und zudem meist die finanziell aufwendigste für die jeweilige
Obrigkeit. Strafen an Leib und Leben sowie Landesverweisung blieben auch nach der
Einführung von Zuchthausstrafen noch längere Zeit in Gebrauch (8). Die Bremische
Armenordnung von 1658 unterscheidet die "Hausarmen", die ein Recht auf die Unterstützung
der Gemeinde haben und die "frembden Armen", die nach dem Erhalt eines Zehrpfennigs in
der Regel die Stadt wieder verlassen müssen. "Sollten auch nächst publicirter dieser Ordnung
einige Arme sich gelüsten lassen, dem Bettel auf den Gassen und an den Thüren nachzuhängen, ... so soll ihnen die Pfrunde oder Almosen entweder auf eine Zeitlang entzogen,
oder nachdem sie betreten wohl gar mit Anderen, die der Aufhebung nicht würdig
abgeschaffet oder ins Werkhaus gebracht werden." (9) Das Werkhaus war somit zuerst für die
"undisziplinierten" Hausarmen gedacht. Fremde Bettler sollten aus der Stadt verwiesen
werden und nur im Widerstandsfall hatten die Bettelvögte die Möglichkeit, sie vorübergehend
in ein Gefängnis einzuweisen.
Die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft mit ihrer kapitalistischen Produktionsweise wurde von Bettlern, Vaganten und anderen Randgruppen nicht prinzipiell in Frage gestellt. Indirekt unterstützten diese Randgruppen sogar teilweise die Entwicklung des Kapitalismus durch die Infragestellung der Ständepyramide.
Eigentumsdelikte zielen direkt in das Herz der bürgerlichen Gesellschaft. Die Bekämpfung von
Eigentumsdelikten wird zur Hauptaufgabe, so werden zwischen 1850-1871 94,1% der
Zuchthaussträflinge wegen Eigentumsdelikten inhaftiert. Neben der veränderten staatlichen
Repressionsrichtung nach 1800 führte natürlich auch ganz wesentlich der Pauperismus zu dem
Anstieg der Eigentumsdelikte.
Diebstahlsdelikte sind die Hauptursache für die Einweisung von Männern in das Zuchthaus.
Junge Männer werden häufiger als Frauen auf Grund von Eigentumsdelikten eingewiesen (10).
Alte Männer wurden eher in das Zuchthaus eingewiesen als alte Frauen (11). Dies sind Gründe,
weshalb Männer nicht nur in der absoluten Anzahl sondern auch relativ häufiger in das
Zuchthaus eingewiesen wurden (12).
Der erste im Armenhaus untergebrachte Häftling (1724) wurde wegen eines Diebstahles
eingewiesen. Er war ein neunzehnjähriger Handarbeiter mit unbekanntem Geburtsort (13), der
wie sehr viele Häftlinge in der Anfangszeit auf der Burg verstarb (6. Juli 1729). Die Einweisung in das Armenhaus auf Grund von Eigentumsdelikten ist jedoch später die Ausnahme
geblieben. Neben Krankheit, Armut und Wahnsinn übersteigt die Summe der anderen
Einweisungsgründe für den Gesamtzeitraum nicht einmal 5,8%. Zwischen dem Zucht- und Armenhaus bestand bereits vor 1800 eine klar erkennbare Aufgabentrennung. Im Armenhaus
wurden überwiegend mittel- und/oder hilflose Menschen untergebracht. Der Aufgabe der
Betreuung entsprachen im Verlauf der Zeit sich letztlich durchsetzend die Einweisungsgründe.
Ab 1825 gibt es dann keine anderen Einweisungsgründe mehr in das Armenhaus als Krankheit,
Armut oder Wahnsinn.
| Zeitraum | andere Einweisungsgründe als KrankArm und Wahnsinn in das Armenhaus in % | Anzahl der anderen Einweisungs- gründe |
absolute Antwort- anzahl |
|
| 1724-1749 | 10,6% | 9 | 85 | vgl.: 8.3.9.1. Straftaten - Anstalten - Einweisungszeitraum (1724-1749), S. 130. |
| 1750-1774 | 12,7% | 12 | 95 | vgl.: 8.3.9.2. Straftaten - Anstalten - Einweisungszeitraum (1750-1774), S. 131. |
| 1775-1799 | 1,6% | 2 | 131 | vgl.: 8.3.9.3. Straftaten - Anstalten - Einweisungszeitraum (1775-1799), S. 133. |
| 1800-1824 | 4,6% | 4 | 130 | vgl.: 8.3.9.4. Straftaten - Anstalten - Einweisungszeitraum (1800-1824), S. 134. |
| 1825-1849 | 0% | 0 | 60 | vgl.: 8.3.9.5. Straftaten - Anstalten - Einweisungszeitraum (1825-1849), S. 135. |
Die Einweisungspraxis unterschied das Armenhaus vom Zuchthaus. Im Zuchthaus wurde
anfangs auch ein großer Teil der Kranken, Armen und Wahnsinnigen inhaftiert. Die
institutionelle Trennung zwischen Armen- und Zuchthaus war erst ab 1800 keine
Einbahnstraße mehr. Die Aufnahme von Armen, Kranken und Wahnsinnigen in das Zuchthaus
ergibt sich aus den Intentionen, die zur Gründung des Zuchthauses führten. Arme wurden in
das Zuchthaus eingewiesen, um die Bettelei zu bekämpfen. Kranke und Wahnsinnige sind
einerseits auf Grund fehlender anderer Versorgungseinrichtungen und andererseits auf Grund
der Ausgrenzungspolitik gegenüber den Randgruppen der Gesellschaft in das Zuchthaus
eingeliefert worden (14).
| Zeitraum | Anteil der KrankArm im Zuchthaus | Anteil der Wahnsinnigen im Zuchthaus | absolute Antwortzahl | |
| 1724-1749 | 17,0% | 31,5% | 25 | vgl.: 8.3.9.1. Straftaten - Anstalten - Einweisungszeitraum (1724-1749), S. 130. |
| 1750-1774 | 23,7% | 45,5% | 54 | vgl.: 8.3.9.2. Straftaten - Anstalten - Einweisungszeitraum (1750-1774), S. 131. |
| 1775-1799 | 5,3% | 4,3% | 6 | vgl.: 8.3.9.3. Straftaten - Anstalten - Einweisungszeitraum (1775-1799), S. 133. |
| 1800-1871 | 0% | 0% | 0 | vgl.: 8.3.9.4. Straftaten - Anstalten - Einweisungszeitraum (1800-1824), S. 134; 8.3.9.5. Straftaten - Anstalten - Einweisungszeitraum (1825-1849), S. 135; 8.3.9.6. Straftaten - Anstalten - Einweisungszeitraum (1850-1871), S. 136. |
Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Entkriminalisierung der Armut so weit fortgeschritten, daß
den Zeitgenossen nicht nur die strikte institutionelle Trennung notwendig ist, sondern auch,
daß das räumliche Nebeneinander von Armenhaus und Strafanstalten ihnen als ein zu
verändernder Zustand erscheint. Die veränderte Handhabung des Deliktes Armut kann als ein
Spiegel für die sich vollzogenen sozialen Veränderungen um 1800 angesehen werden. Deutlich
wird an diesem Beispiel, daß im Verlauf der Zeit sich die Kriterien für eine Einweisung in die
Anstalten wandelten. Erst nach dem Wandel der Einweisungskriterien, nachdem die
Bekämpfung von Randgruppen nicht mehr im Mittelpunkt der Strafverfolgung stand, konnte
eine klare institutionelle Differenzierung zwischen den Anstalten erfolgen. Das Armenhaus auf
der Leuchtenburg war eine staatliche Gründung. Dies sicherte den Bestand der Anstalt für
mehr als ein Jahrhundert, denn es war nicht abhängig von milden Stiftungen bzw. dem
Engagement einzelner Personen (15). "Am 1. August starb Melchior Heumer aus Spohra, der
letzte Arme mit welchem sich also das Armenhaus hier schloß." (16) Jedoch aus den Häftlingslisten ist ersichtlich, daß auch nach 1840 weitere sieben Personen in das Armenhaus
eingewiesen wurden (17).
Die Existenz einer separaten Irrenanstalt ist aus der Quelle erst ab dem 11.02.1847 ersichtlich
(18). In der Zeit zwischen 1840, dem Zeitpunkt der Schließung des Armenhauses lt. Ortschronik
und 1847, der erstmaligen Erwähnung der Irrenanstalt, werden nur Geisteskranke und ein
Epileptiker in das Armenhaus eingewiesen. Bereits am 16.08.1848 werden die letzten
Geisteskranken in das Genesungshaus nach Roda (Stadtroda) überführt. Damit schließen das
Irrenhaus und Armenhaus auf der Leuchtenburg endgültig ihre Pforten.
Eine institutionelle Trennung von Armen- und Irrenhaus ist aus der Quelle nicht erkennbar.
Geisteskranke werden in das Armenhaus eingewiesen (19). Das Irrenhaus wird erst nach der
Schließung des Armenhauses lt. Ortschronik erwähnt. Im gesamten Untersuchungszeitraum
waren die Insassen des Armenhauses überwiegend (zu 3/4) Geisteskranke (20).
| Zeitraum | Wahnsinn absolute Antwortzahl |
Wahnsinn % |
KrankArm absolute Antwortzahl |
KrankArm % |
|
| 1724-1749 | 37 | 43,5% | 39 | 45,9% | vgl.: 8.3.9.1. Straftaten - Anstalten - Einweisungszeitraum (1724-1749), S. 130. |
| 1750-1774 | 54 | 56,8% | 29 | 30,5% | vgl.: 8.3.9.2. Straftaten - Anstalten - Einweisungszeitraum (1750-1774), S. 131. |
| 1775-1799 | 111 | 84,7% | 18 | 13,7% | vgl.: 8.3.9.3. Straftaten - Anstalten - Einweisungszeitraum (1775-1799), S. 133. |
| 1800-1824 | 116 | 89,2% | 8 | 6,2% | vgl.: 8.3.9.4. Straftaten - Anstalten - Einweisungszeitraum (1800-1824), S. 134. |
| 1825-1849 | 54 | 90,0% | 6 | 10,0% | vgl.: 8.3.9.5. Straftaten - Anstalten - Einweisungszeitraum (1825-1849), S. 135. |
Die fehlende berufliche Qualifikation des Pflegepersonals für die Tätigkeit konnte vielleicht im
Einzelfall durch persönliches Einfühlungsvermögen etwas aufgewogen werden. Das
Aufsichtspersonal scheint jedoch nicht sehr sorgfältig ausgewählt gewesen zu sein. Auch
ehemalige Häftlinge erhalten eine Anstellung als Aufseher (21). Die "Betreuung" der
Geisteskranken führte sicher nur in Ausnahmefällen zu einer Besserung des Krankheitsbildes,
lange Inhaftierungszeiten sind die Folge (22), oft bis zum Tod des Häftlings.
Die Veränderungen des Umgangs mit den Geisteskranken in der Gesellschaft (23) spiegeln sich
deutlich zuerst in der institutionellen Differenzierung der Leuchtenburger Anstalten und dann
in der Auflösung des Irrenhauses wider. Nach 1800 werden keine Häftlinge auf Grund einer
Geisteskrankheit mehr in das Zuchthaus eingewiesen. Die Auflösung des Irrenhauses, welches
wohl mehr den alten Tollhäusern vergleichbar war (24), entsprach den neuen Vorstellungen, die
die Insassen "als Kranke jetzt in ihrer Menschenwürde respektierten und (auf die) medizinisch-
psychologisch aufgefaßten Patienten einzuwirken suchte(n)" (25).
Frauen waren überproportional im Armenhaus vertreten (26). Unterstützungsbedürftige Männer
wurden eher in das Zuchthaus eingewiesen (27).
Die erste Inhaftierte des Korrektionshauses ist am 20.08.1812 eine siebzigjährige Witwe. Die
Aufgabe des Korrektionshauses bestand in der sozialen Disziplinierung der Delinquenten. Das
ergibt sich aus der Art der Delikte, die zu einer Einweisung führten (28). In der Anfangszeit
(1825-1849) wurden noch 11 Häftlinge (11,8%) auf Grund von Eigentumsdelikten
eingewiesen (29). Nach 1850 sanken die Eigentumsvergehen auf zu vernachlässigende 1,5% und
sozial disziplinierende Verurteilungen und Straftaten, die nur von Frauen begangen werden
können (30), stiegen auf 98,3% als Einweisungsursache (31). Auf Grund von Straftaten, die nur,
bzw. hauptsächlich, von Frauen begangen werden können, sind die meisten Häftlinge jedoch
vorzugsweise in das Zuchthaus eingewiesen worden (32).
Die ursprüngliche Aufgabe des Zuchthauses, die Bekämpfung von Bettlern, Vaganten und liederlichem Volk, erfüllte nun eine spezialisierte Anstalt.
Insgesamt befanden sich zwischen 1812 und 1871 333 Häftlinge im Korrektionshaus. Bis 1844
waren es nur 38 Korrigenden. In den Jahren danach wurden zunächst drastisch mehr und dann
wieder weniger Häftlinge ins Korrektionshaus eingewiesen (33). Frauen wurden relativ häufiger
ins Korrektionshaus eingeliefert (34).
Das Landarbeitshaus bzw. Arbeitshaus war neben dem Zuchthaus die Anstalt mit den meisten
Insassen. Zunächst wurde das Landarbeitshaus 1840 in Betrieb genommen (35). Nach der
Ortschronik wird das Landarbeitshaus am 4. Oktober 1842 eröffnet. Damit beginnt die
Nutzung des extra aufgestockten Hauses des Hausverwalters (heute Jugendherberge) (36). 1846
wird das Arbeitshaus in der Quelle erstmals erwähnt (37). Die Häftlinge des Arbeitshauses
erledigten gewerbliche Arbeiten (38).
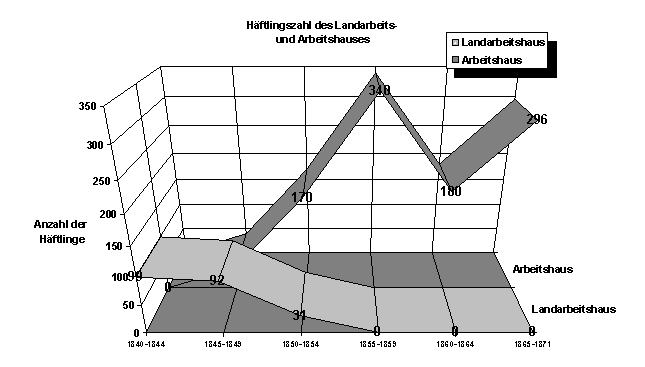 (39).
(39).
Im vorherrschend ländlich geprägten Thüringen ist die naheliegende Beschäftigung der
Häftlinge zunächst Landarbeit. Zur Leuchtenburg gehörten Ländereien auf den beiden
umliegenden Bergen. Die Häftlinge des Landarbeitshauses bestellten diese Felder. Die
Pastoren berichten in der Ortschronik kontinuierlich und zum Teil sehr ausführlich über die
Ernteerträge, ein Beleg für die noch starke ländliche Prägung des Umfeldes. Die Ernte diente
mit zur Versorgung der Häftlinge. Dadurch konnten die Kosten für den Betrieb der Anstalten
geringer gehalten werden. Die Bewachung der Häftlinge war bei Feldarbeiten außerhalb des
Gefängnisses problematisch und die sich durchsetzende Industrialisierung bot neue
Möglichkeiten sinnvoller Beschäftigung innerhalb der Anstalt (40). Im Rahmen der
merkantilistischen Wirtschaftsförderung der Landesherren sind Zucht-, Arbeits-, Werk-,
Spinn-, Waisen- und Korrektionshäuser wiederholt zur Etablierung von Manufakturen benutzt
worden (41). Die oft überschätzte Bedeutung der Manufakturen erläutert Wehler. Die
Beschaffung geeigneter Arbeiten scheint auf der Leuchtenburg immer mit vielen Problemen
verbunden gewesen zu sein (42). Ein Zeitgenosse (1776) schreibt über die Torgauer Anstalt,
daß die Züchtlinge "zu mancherley Arten von häuslicher und Fabrikarbeit mit dem besten
Erfolg angehalten" (43) wurden.
Festungshaft war keine entehrende Strafe. Der "gute Ruf" ist ein wesentlicher sozialer Faktor. Gefängnisstrafen sind entehrend und führen zum Ausschluß aus den Gemeinschaften (Dorf, Gilde etc.). Selbst das Gebäude des Zuchthauses stand unter solchem Stigma. "Bei vorfallenden Reparaturen unehrlicher Gefängnißlocale mußte die Obrigkeit dieselben erst für ehrlich erklären, bevor die Handwerker an's Werk schritten. Noch im Jahre 1772 mußte man in Wien diesen Exorcismus vornehmen." (44)
Widerstand gegen Vorgesetzte oder den Staat waren die Einweisungsursache (45). Das
Strafmaß war mit oft 10 Jahren sehr hoch. 14 Häftlinge zählte dieser Anstaltstyp für den
gesamten Untersuchungszeitraum. In der Anstalt waren die "Revolutionäre" unter sich. Sicher
ist die Leuchtenburg kein Stammheim hinter "finsteren" Burgmauern gewesen. Die soziale
Stigmatisierung der Tat erfolgte nicht, die Häftlinge hatten einen Sonderstatus, verbunden mit
manchen Vergünstigungen.
Das Staatsgefängnis diente nicht der Inhaftierung der unterbürgerlichen Schichten (46), auf die
sich diese Arbeit konzentriert. Die Einweisungsursachen variierten stark, mehrere
Geisteskranke (zum Teil adlig), ein Bankrotteur bis hin zu Studenten, die sich duelliert hatten.
Im Untersuchungszeitraum waren in dieser Anstalt zehn Personen inhaftiert. Die Häftlinge
wurden als Staatsgefangene, Arrestanten und Baugefangene bezeichnet.
Die Untersuchungsgefangenen sind auf Grund von Eigentumsdelikten inhaftiert gewesen. Da
es nur drei Inhaftierte gab, ist dieser Anstaltstyp für die Leuchtenburg nicht relevant.
|
|

|

|
|